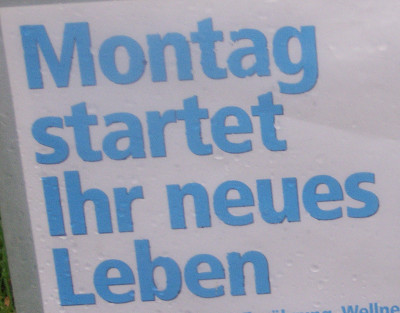Gerade mal vierzig Beiträge und schon in der Blogkrise. Weil: andere (Blogger) schreiben über wichtige(re) Dinge, wollen was bewegen in der Welt, haben eine Meinung, schreiben ihre Meinung, erleben viel interessantere Sachen (als ich), und so weiter und so fort.
Mit Vergleichen kann man sich das Leben bekanntlich ziemlich schwer machen.
Ich habe jedenfalls beschlossen, dass mir das egal ist sein sollte. Was soll’s, schreib ich halt trotzdem über mich und was so passiert, beziehungsweise was eben nicht passiert in meinem Leben. Spaß macht das nämlich – zumindest, wenn ich es einfach tue und nicht stundenlang darüber nachdenke.
Da ich außerdem lieber schreibe als rede, erzähle ich hier manches, über das ich wohl eher nicht (oder nur nach beharrlichem Nachfragen) reden würde.
Dann treffe ich jemanden (so in echt, mit Anfassen und so) und der weiß plötzlich Dinge über mich und ich wundere mich und denke: Hä? Warum weiß der das?
Und dann stellt sich raus, der liest hier mit. Und ich denke: O Gott. Nie wieder schreib ich hier was, das kann ja jeder lesen.
Aber als nächstes stellt sich raus, dass es so schlimm gar nicht ist, denn plötzlich rede ich mit jemandem über Dinge, die ich sonst nicht erzählen würde (oder nur nach beharrlichem Nachfragen, siehe oben).
Und vielleicht klappt es nach 284 Beiträgen ja auch mal mit den wichtigen Dingen. Welt verbessern und so.