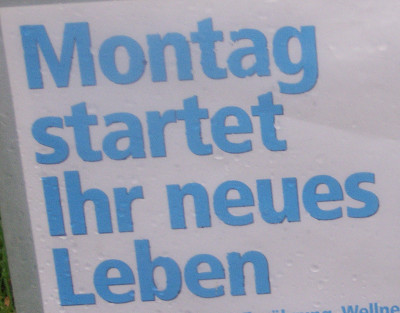Mal eben bei den Österreichern gewesen. Jetzt warte ich auf Montag.
Monat: April 2014
Paragraph 43 oder: Der Seuche ein Schnippchen schlagen.
Gestern habe ich an einer Veranstaltung teilgenommen, die man unter dem kürzlich irgendwo (leider habe ich vergessen, wo genau) aufgeschnappten: „Esst mehr Desinfektionsmittel!“ zusammenfassen könnte.
Das dauert Stunden, warnte die Kollegin im Voraus. Sie sollte Recht behalten. Wobei die Veranstaltung an sich erstaunlich schnell vorüber war. Aber die Formalitäten! Erst die Anmeldung (Aber immer nur einer!), dann der heimtückische Kassenautomat, später den Beweis dafür abholen, dass man tatsächlich teilgenommen hat. Und auch bezahlt hat (Wo habe ich noch gleich die Quittung hingetan?). Während des Wartens auf Geschichten lauern. Da wäre die Beamtin mittleren Alters, die man in einem Roman fürchterlich vorhersehbar finden würde. Klischee!, würde man vor sich hingrummeln und darauf hoffen, es selbst besser zu machen. Aber nun ja, das Leben ist manchmal genauso vorhersehbar wie (schlechte) Romane. Dies bestätigte sich auch während Teil 3 der Veranstaltung (Teilnahmebescheinigung abholen). Da wurde man nämlich mit Namen aufgerufen und hätte jemand mit mir gewettet, welcher Teilnehmer bei „Frederic …, bitte“ aufstehen wird, ich hätte die Wette gewonnen.
Sterbenslangweilig – das war eine weitere Warnung besagter Kollegin (sinngemäß, jedenfalls). Es zeigte sich (mal wieder), dass ich mich über das, was andere langweilig finden, kaputtlachen könnte kann. Dabei ist das eine ernste Sache. Aber wie kann ich etwas ernst nehmen, wenn im alles zusammenfassenden Film drei junge Männer vor einer Imbissbude gezeigt werden, die (vermutlich) Currywurst mit Pommes essen und (ganz sicher) Cola dazu trinken und der Kommentator etwas von „ausgewogenen Mahlzeiten“ redet?
Sollte mich mal wieder jemand auf meinen (zu hohen) Cola-Konsum hinweisen, weiß ich nun wenigstens das (Gesundheits)Amt auf meiner Seite. Dummerweise bin ich es meistens selbst, die beim Gedanken an ebenjenen Cola-Konsum das schlechte Gewissen plagt.
Was ich ebenfalls auf gewisse Weise herrlich absurd fand: Als in ebenjenem Film eine blitzblanke Gastronomieküche gezeigt wurde und ebenjener Kommentator so etwas sagte wie: „Noch ist alles gut … aber da kommt sie schon, die Gefahr.“
Und – tadaa – Auftritt der Mitarbeiter. Des Bösen. Die den Keim mit sich tragen.
Ich weiß. Das macht natürlich alles Sinn und so. Und doch.
Sandgestrahlt. Oder: beim Zahnarzt.
Das ist mein Zahnarztball. Vor vielen Jahren habe ich ihn von einer lieben Freundin geschenkt bekommen, aus Gründen, die mit Zahnärzten rein gar nichts zu tun haben. Diese Gründe haben sich mittlerweile erledigt, der Ball jedoch nicht, denn er ist von allerbester Zahnartzballkonsistenz: nicht zu hart, nicht zu weich.
Es soll ja Leute geben, deren Zahnarztbesuche sich hauptsächlich auf ein: „Alles prima, dann bis zum nächsten Mal“ beschränken. Ich gehöre definitiv nicht zu diesen Leuten. Mein Zahnarztball ist mittlerweile ziemlich abgenutzt. „Sie sind ja zum Glück nicht so empfindlich“, meinte die freundliche ZFA (oder ZMF?) heute. Hm. Vielleicht bin ich auch nur Meister im „so tun, als ob“. Aber meistens brauche ich ihn tatsächlich nicht (mehr), den Ball, jedenfalls nicht aktiv, ich habe ihn in der Hand, um etwas in der Hand zu haben und allein der Gedanke, dass ich bei Bedarf fest zudrücken könnte, hat etwas Beruhigendes.
Wer jetzt nicht versteht, dass ich bei Zahnärzten zu derartigen Mitteln der Beruhigung greife, hat wohl noch nie eine Wurzelbehandlung mitgemacht. Oder sich Weisheitszähne heraussägen lassen. Oder andere unangenehme Dinge, von denen ich gar nicht erst anfangen will.
Heute habe ich ihn jedenfalls doch wieder gebraucht, den Ball, obwohl „nur“ eine harmlose Zahnreinigung eingeplant war. Normalerweise nutze ich Zahnreinigungen mittlerweile, um mich in Meditation zu üben. Tja. Heute fühlen sich nicht nur meine Zähne sandgestrahlt an.
Und natürlich endete das Ganze auch nicht in: „Prima. Dann bis zum nächsten Mal“, sondern in: „Hm. Nicht ganz so prima. Wie passt es ihnen nächste Woche?“
Ahoi/j zum zweiten, oder: wenn einem plötzlich ein Licht aufgeht.
Nämlich warum das Ahoj und nicht Ahoi heißt. Ahoj ist tschechisch und heißt Hallo.
Das weiß ich, seit ich neuerdings tschechisch lerne. Genau genommen habe ich vor einer halben Stunde erst damit angefangen und eigentlich lerne ich es auch nicht wirklich, ich will nur so grundlegende Dinge wie: „Was heißt Bitte und Danke und wie spreche ich das aus“ herausfinden. Danke kann ich schon abhaken, Dĕkuji heißt das. Oder: Dĕkuju. Was es mit dem „i“ beziehungsweise dem „u“ am Wortende auf sich hat, habe ich leider noch nicht herausgefunden.
Ist ja noch ein bisschen Zeit. Bis Mitte Mai ungefähr. Dann werde ich sehr wahrscheinlich einen Tschechien-Ausflug machen und nachdem ich mich beim letzten Tschechien-Ausflug eher plötzlich und überraschend dort wiederfand (und kaum wieder herausgefunden habe, aber das ist eine andere Geschichte), will ich beim nächsten Mal zumindest des Bitte, Danke und Guten Tags mächtig sein.
Zumal ich jedes Mal fürchterlich neugierig werde, wenn ich fremde Sprachen höre. Was reden die da eigentlich, frage ich mich dann immer wieder aufs Neue. Was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich immer noch ein bisschen Ungarisch kann, auf Norwegisch unnütze Dinge wie: Skriver du ofte brev? (Schreibst du oft Briefe?) fragen kann und immer noch unsägliche so-lernen-Sie-Italienisch-Ohrwürmer im Kopf habe, in denen es zum Beispiel darum geht, mit Signor Rossi die Farben der Welt zu betrachten. Das Französisch und Spanisch, das ich vor unendlichen Jahren in der Schule gelernt habe, ist dagegen (leider) ziemlich in Vergessenheit geraten.
Ungarisch kann übrigens auch in Österreich ganz praktisch sein: dann nämlich, wenn andere noch über den Karfiol (Blumenkohl) auf der Speisekarte rätseln.
Neulich während der Arbeit unterhielten sich zwei und ich verstand auch kein Wort. Thailändisch sei das, stellte sich auf Nachfrage heraus. Hehe.
Aber bis Mitte Mai ist erst einmal Tschechisch dran.
Sonntagsausflug.
Indiebookday, nächster Versuch.
War der jetzt erfolgreich? Ich habe mir jedenfalls den Koala von Lukas Bärfuss aus dem Wallstein Verlag gekauft.
In meiner Lieblingsbuchhandlung, in der ich gestern erneut feststellen konnte, dass sie nicht ohne Grund meine Lieblingsbuchhandlung ist. Leider viel zu weit weg. Wobei, das ist vielleicht ganz gut so, ansonsten würde ich vermutlich noch öfter noch mehr Bücher nach Hause tragen.
Jedenfalls finde ich da immer Bücher, die es in anderen Buchhandlungen nicht gibt. Oder sie sind dort besser versteckt.
Die Buchhändlerin hat mich dann auch gleich noch von Katharina Hagenas Vom Schlafen und Verschwinden überzeugt.
Und meinen Indiebookday werde ich in demnächst auf jeden Fall erfolgreich zu Ende bringen: indem ich mir Claire Keegans Das dritte Licht bestelle. Aus dem Steidl Verlag.
Das Buch habe ich in der Bücherei gefunden. Gelesen habe ich es auch schon, aber nicht zum letzten Mal. So wenig Worte, so viel gesagt. Ich mag Bücher, die durch nichts sagen viel sagen. Das ist so eins.
So einfach ist das.
Ich weiß es doch. Eigentlich. Was mir gut tut.
Raus.
So lange laufen, bis die Gedanken still stehen, bis die Stille von draußen in mir angekommen ist.
Die Stille des (vogel-)geschwätzigen Frühlingswaldes, des schnaubenden Pferdes, der malmenden Kühe, des dahinhoppelnden Hasens; die Stille im Schrei des Greifvogels, im Surren der Fliege; die Stille in der sonnigen Wärme des Sandbodens und im ausgeblichenen Holz der Sitzbank, in der grazilen Leichtigkeit des Waldmeisters, im satten Gelb der Sumpfdotterblumen, in der Maßlosigkeit des Löwenzahns; die Stille im steten Fluss des Bachlaufs, in der Samtigkeit der jungen Blätter des Fingerhuts, in der Sorglosigkeit der Schmetterlinge, in der ruhenden Kühle der Granitblöcke, die Stille in den Bäumen.
So einfach ist das.
Serendipity.
(Leo übersetzt Serendipity so: „die Gabe, zufällig glückliche und unerwartete Entdeckungen zu machen“)
Auch so ein schönes Wort. Von dem ich zum ersten Mal bei Meike Winnemuth gelesen habe. Und gleich dachte: Ah, das kenne ich auch.
Heute ist es wieder passiert: eine zufällige und unerwartete Entdeckung, dieses Mal beim Radiohören. Stefan Parrisius redet mit Zoë Beck, von der ich gar nicht wusste, dass sie irgendwann mal nicht Zoë Beck hieß. Sondern Henrike Heiland. Namen gibt es. Und damit bin ich dann bei der Serendipity, denn Zoë Beck hat sich den Namen Zoe ausgesucht, weil Zoe Leben bedeutet.
Ich höre das und denke: Kann jetzt nicht sein, oder?
Kann aber doch sein.
Warum mich das so erstaunt: In meiner Geschichte (die Geschichte, die immer noch ein „richtiges“ Buch werden will) gibt es auch eine Zoe. Die hieß einfach so, da hatte ich noch keine Ahnung, was der Name bedeutet. Jedenfalls: er passt.
Mehr Regen, bitte.
Danke. Das ging ja schnell.
Falls Ihnen heute ein breit grinsender Mensch auf einem Fahrrad entgegen kam, der mehr oder weniger laut „I’m only happy, when it rains“* gesungen hat: das war ich.
Regen ist immer dann toll, wenn man weiß, wo die nächste heiße Dusche auf einen wartet. Ich bin ja gern zu Fuß unterwegs und da lässt es sich leider nicht vermeiden, auch mal nass zu werden.
Zum Beispiel wenn man trotz eines drohenden Gewitters vom Berg des Grauens flüchtet. Und dann – natürlich – fürchterlich nass wird, während man versucht, die Blitze zu ignorieren und sich fragt, was der Schutzengel bei diesem Wetter wohl so treibt. Und schließlich vor einem rettenden Häuschen steht, in dem man zwar keine heiße Dusche, dafür aber einen heißen Espresso bekommt. Dann geht man wieder raus in den Regen. Wenigstens die Blitze haben ihre Arbeit eingestellt. Später steht man triefend und tropfend vor einem ausgestopften Wildschwein (der aufmerksame Leser erinnert sich), während man darauf wartet, dass die Wirtin, die einen eben noch entgeistert angestarrt hat, ein paar Betten bezieht und nach Handtüchern sucht.
Oder man steht ebenso triefend vor einem Haus, dass laut einer vergilbten Infotafel in der Ortsmitte ein Gästezimmer beherbergen sollte (das einzige im ganzen Ort). Jetzt, wo man davor steht, deutet allerdings nichts darauf hin, dass es tatsächlich so ist. Man klingelt beherzt, wird erneut entgeistert angestarrt und tropft Pfützen ins Gästezimmer, während die Wirtin allerlei uninteressante Dinge erzählt und sich darüber freut, nach vielen Jahren mal wieder einen Gast zu haben. Später ist man zwar längst wieder trocken, fragt sich aber, ob es nicht besser wäre, wieder in den Regen zu flüchten: einer der Hausbewohner scheint ein großer Fan von Phil Collins zu sein, hört ebenjenen auf maximaler Lautstärke und findet auch nach der zehnten Wiederholung noch Gefallen am immer gleichen Lied.
Da ist es schon fast nicht mehr der Rede wert, wenn man durch eins der angeblich trockensten Alpentäler** wandert, während vor lauter Nässe schon die Schuhe quietschen.
Oder wenn man glaubt, die heiße Dusche sei zum Greifen Aufdrehen nahe und aus dem Duschkopf kommt nur lauwarmes Wasser.
Ja, in solchen Momenten komme ich dann schon mal ins Grübeln, wessen Schnapsidee die Sache mit dem Wandern eigentlich war. Dummerweise oft genug meine eigene.
Oh, eine Regengeschichte hab ich noch: Wenn man triefend und tropfend vor der Rezeptions eines Sternehotels steht und überhaupt nicht entgeistert angestarrt wird. Wenn man das Zimmer gezeigt bekommt und dezent auf den im Schrank versteckten Föhn hingewiesen wird („Den brauchen Sie sicher noch“). Wenn man im ganzen Zimmer nasses Zeug ausbreitet, essen geht, schlafen geht und am nächsten Morgen feststellt, dass derjenige, der unnötigerweise ins Zimmer kam, um die Tagesdecke zurückzuschlagen, auch die Schranktüren geschlossen hat. Die man selbst wohlweislich aufgelassen hatte, wegen dem nassen Zeug, dass darin hängt. Das nasse Zeug, das jetzt immer noch nass ist.
Ja, ich sollte mal wieder wandern gehen.
* normalerweise singen das andere, nämlich: Garbage
** das Pitztal, und diese Behauptung hatten wir tags zuvor in einem vor Ort ausliegenden Buch oder einer Broschüre gelesen.
Immer wenn es regnet*
Das Beste am Frühling ist der Regen. Tagelang dieses dunstige 20-Grad-Wetter, bei dem ich im Gegensatz zur Katze ganz dösig werde und mich frage, wann er endlich kommt: der Regen, der den Himmel gründlich durchwäscht, damit man auch mal wieder die Berge in der Ferne sieht (Berge, schön wär’s. Sind leider nur Hügel).
Und dann – heute! Endlich.
Vermutlich habe ich nur wegen dem Regen mal wieder länger gebraucht und meine Vier-Stunden-Schicht gründlich überzogen. Weil ich ständig am offenen Fenster stand und nach links guckte. Dahin, wo es schon regnete. Jesses, das dauerte aber auch, bis die dunklen Wolken endlich zu mir kamen.
Als sie dann da waren, stand ich natürlich immer noch am offenen Fenster, weil: dieser Geruch! Hach. Komisch, im Winter riecht Regen anders. Aber der Winter ist ja eh dazu da, dass es schneit. Eigentlich.
Apropos: der MMM berichtet, in Norwegen sei es brausekalt und die Seen wären zum Teil noch zugefroren. Die haben’s gut, die Norweger.
Zurück zum Regen. Leider nicht genug davon. Ich hatte mich darauf gefreut, nach der unendlichen Vier-Stunden-Schicht entweder
a) Im Regen nach Hause zu laufen
Oder
b) Ohne Regen nach Hause zu laufen, aber mit den Handflächen an nassglitzernden Buchsbaumhecken entlangzustreifen.
Pustekuchen.
Hat noch nicht mal für Nassglitzer auf Buchsbaumhecken gereicht. Mehr Regen, bitte.
* Titel sponsored by Freundeskreis
edit: Ja sowas. Man findet hübsche Bilder, wenn man nach „Immer wenn es regnet“ sucht.